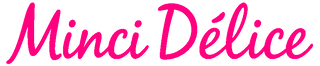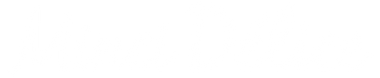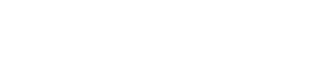Warum jetzt über Proteine im Alter sprechen?
Ab 50 verliert der Körper jährlich ein bis zwei Prozent seiner Muskelmasse. Hört sich wenig an? Über zehn Jahre summiert sich das zu einem Verlust von bis zu 20 Prozent. Das Ergebnis: Treppen werden zur Herausforderung, Einkaufstaschen plötzlich schwer, Stürze häufiger.
Dabei ließe sich dieser schleichende Abbau oft aufhalten. Eine ausreichende Proteinzufuhr kombiniert mit gezielter Bewegung kann die Muskelkraft stabilisieren. Doch viele Senioren essen zu wenig Eiweiß, weil sie keinen Appetit haben, allein wohnen oder denken, Fleisch und Fisch seien im Alter verzichtbar.
Was sagen aktuelle Studien aus 2024 und 2025?
Europaweit leiden zwischen 15 und 20 Prozent der über 65-Jährigen an Sarkopenie, also krankhaftem Muskelschwund. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, weil viele Betroffene ihre Symptome als normale Alterserscheinung abtun.
Fachgesellschaften empfehlen gesunden Älteren mittlerweile 1,0 bis 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Bei Gebrechlichkeit oder bereits diagnostizierter Sarkopenie steigt der Bedarf auf 1,2 bis 1,5 g/kg. Zum Vergleich: Jüngere Erwachsene kommen meist mit 0,8 g/kg aus.
Warum dieser Unterschied? Mit dem Alter sinkt die sogenannte anabole Sensitivität. Einfach gesagt: Ältere Muskeln brauchen mehr Eiweiß, um genauso effizient aufgebaut zu werden wie junge.
Proteinquellen clever kombinieren
Nicht alle Eiweiße sind gleich. Die biologische Wertigkeit entscheidet darüber, wie gut der Körper das Protein verwerten kann. Tierische Quellen wie Eier, Milchprodukte, Fisch und mageres Fleisch liegen vorn. Pflanzliche Proteine aus Hülsenfrüchten, Nüssen oder Tofu sind ebenfalls wertvoll, sollten aber kombiniert werden.
Ein Beispiel: Linsen mit Reis ergeben zusammen ein vollständiges Aminosäureprofil. Hummus mit Vollkornbrot ebenso. Wer flexibel bleibt und verschiedene Quellen nutzt, versorgt den Körper optimal.
So könnte ein proteinreicher Tag aussehen
Frühstück: 150 g Quark mit Beeren und einem Esslöffel Mandeln. Mittagessen: Lachsfilet mit Kartoffeln und Brokkoli. Zwischenmahlzeit: Hartgekochtes Ei oder ein kleiner Joghurt. Abendessen: Linsensuppe mit Vollkornbrot.
Diese Verteilung liefert etwa 80 bis 90 Gramm Protein bei einem Körpergewicht von 70 Kilogramm. Das entspricht den aktuellen Empfehlungen und lässt sich im Alltag umsetzen, ohne dass Essen zur Pflichtübung wird.
Verteilung schlägt Menge
Ein häufiger Fehler: Das meiste Eiweiß landet beim Abendessen auf dem Teller. Besser wäre es, die Proteinzufuhr auf drei bis vier Mahlzeiten zu verteilen. Warum? Die Muskelproteinsynthese wird durch jede eiweißreiche Mahlzeit neu angeregt. Bei nur einer großen Portion verpufft ein Teil der Wirkung.
Pro Mahlzeit sollten mindestens 20 bis 30 Gramm Protein enthalten sein. Das entspricht etwa 100 Gramm Hähnchenbrust, 150 Gramm Fisch oder 200 Gramm Magerquark.
Praxisbeispiel: Frau K. findet zurück zur Kraft
Frau K., 78, kam vor einem Jahr in die Ernährungsberatung. Sie hatte in zwei Jahren acht Kilo verloren, fühlte sich schwach und mied Treppen. Ihre Proteinzufuhr lag bei unter 50 Gramm täglich, weit unter dem Bedarf.
Gemeinsam stellten wir ihren Speiseplan um: Morgens gab es nun Rührei statt nur Toast, mittags eine Portion Fisch oder Tofu, abends Joghurt mit Nüssen. Nach drei Monaten hatte sie zwei Kilo zugenommen, konnte wieder ohne Pause Treppen steigen und berichtete von mehr Energie.
Dieses Beispiel zeigt: Kleine Änderungen können große Wirkung entfalten, wenn sie konsequent umgesetzt werden.
Vorsicht bei eingeschränkter Nierenfunktion
Eine eiweißreiche Ernährung ist nicht für jeden unbedenklich. Bei chronischer Niereninsuffizienz kann zu viel Protein die Nieren zusätzlich belasten. Deshalb sollten Betroffene ihre Proteinzufuhr nur in Absprache mit dem Arzt anpassen.
Auch bestimmte Medikamente, etwa gegen Bluthochdruck oder Diabetes, können die Verstoffwechselung von Eiweiß beeinflussen. Ein Blutbild und die Überprüfung der Nierenwerte geben Aufschluss darüber, ob eine Erhöhung der Proteinzufuhr sicher ist.
Diabetes? Kein Hindernis
Menschen mit Diabetes profitieren oft sogar von mehr Protein. Eiweiß lässt den Blutzucker langsamer ansteigen als Kohlenhydrate und kann helfen, Heißhungerattacken zu vermeiden. Wichtig bleibt die Gesamtkalorienmenge und die Wahl der Beilagen. Vollkornprodukte und Gemüse statt Weißbrot und Kartoffelpüree.
Wann Proteinpulver sinnvoll ist
Nicht jeder schafft es, den erhöhten Bedarf über normale Mahlzeiten zu decken. Bei Appetitmangel, Kau- oder Schluckbeschwerden können Proteinergänzungen eine praktische Lösung sein. Flüssige Drinks werden oft besser toleriert als feste Nahrung.
Doch Vorsicht: Ergänzungen sollten niemals vollwertige Lebensmittel ersetzen. Sie liefern zwar Eiweiß, aber kaum Vitamine, Mineralstoffe oder Ballaststoffe. Am besten kombiniert man beides: Proteinshake als Zwischenmahlzeit, dazu vollwertige Hauptgerichte.
In fünf Schritten zur sicheren Umsetzung
Wer seine Proteinzufuhr erhöhen möchte, sollte systematisch vorgehen. Erstens: Aktuellen Ernährungsstatus und Nierenwerte ärztlich prüfen lassen. Zweitens: Realistische Zielwerte mit einer Ernährungsfachkraft festlegen. Drittens: Hochwertige Proteine über den Tag verteilen. Viertens: Bei Bedarf Ergänzungen gezielt einsetzen. Fünftens: Regelmäßig den Verlauf kontrollieren und anpassen.
Diese Schritte klingen einfach, erfordern aber Disziplin und Begleitung. Eine individuelle Ernährungsberatung zahlt sich hier aus. Sie berücksichtigt Vorerkrankungen, Medikamente, Vorlieben und Alltagsstrukturen.
Was die Wissenschaft empfiehlt
Die hier vorgestellten Empfehlungen basieren auf aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sowie internationalen Studien zur Proteinzufuhr im Alter. Sie ersetzen keine individuelle medizinische Beratung, bieten aber eine fundierte Orientierung.
Weitere Informationen finden Sie bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und der World Health Organization (WHO).
Wenn Sie unsicher sind, wie viel Protein für Sie persönlich richtig ist, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder einer qualifizierten Ernährungsfachkraft. Eine maßgeschneiderte Planung ist der Schlüssel zu einer sicheren und wirksamen Ernährungsumstellung im Alter.